(14.07.2019) / von Pater Marc Brüllingen
Erneut ist im heutigen Evangelium (Mt 5,20-24) die Rede von der Nächstenliebe. Es sind ernste, strenge Worte, die der Heiland an die Adresse der Pharisäer und Schriftgelehrten richtet. In der äußerlichen Erfüllung des Gesetzes, der peinlichen beobachtung all der bestimmungen der jüdischen Moral- und Ritualvorschriften sahen sie die „Gerechtigkeit“, die wahre Heiligkeit und höchste Vollkommenheit.
Dabei war ihr Herz voller Arglist, Bosheit und Falschheit, voller Grimm und Rachsucht gegen alle, die sie als ihre Feinde ansahen, besonders gegen den verhaßten Galiläer. Ihm, der sie bis auf den Grund ihrer heimtückischen Seele erkannte und durchschaute und sich auch nicht scheute, sie vor allem Volke anzuprangern, wie sie’s verdienten, hatten sie unversöhnliche Feindschaft geschworen!
So verstehen wir denn die Warnung Jesu an das Volk: „Wenn euere Gerechtigkeit nicht vollkommener ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen!“ Man muß eben die Mentalität, die ganze geistige Verfassung der damaligen Juden, insbesondere der Pharisäer und Schriftgelehrten richtig kennen, um den Sinn dieser Worte voll und ganz zu erfassen.
Wer den Haß gegen den Feind zum obersten Gesetze macht, der sieht alles als erlaubt an, jedes Mittel, den Feind zu verderben, die Rache zu kühlen: List, Heuchelei, Verstellung, Lüge und Verleumdung. Wie meisterhaft haben eben dieselben Pharisäer und Schriftgelehrten diese „Kunst“ verstanden, als es galt, ihren größten Feind, Jesum von Nazareth, zu Fall zu bringen!
So werden auch die Worte umso verständlicher, die Christus zur Erläuterung und zur Illustrierung des Gesagten beifügt: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt worden: Du sollst nicht töten! Wenn einer tötet, ist er dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch: Wer über seinen Bruder zürnt, ist dem Gerichte verfallen!“
Wie weit strenger ist doch seine Forderung wahrer Nächstenliebe! Nicht bloß die Tat, nein, auch schon der Gedanke und der Wille, dem Nächsten zu schaden, ist eine Sünde. Und er geht noch weiter: Selbst jedes Schimpfwort, jede Beleidigung und Kränkung des Mitmenschen verdient Strafe Gottes! Sind doch alle Menschen unsere Brüder, weil Gott unser aller Vater ist, der im Himmel wohnt!
Und so ergibt sich daraus von selbst die Mahnung aus dem Munde Jesu: „Wenn du also deine Gabe zum Altare bringst und dich daselbst erinnerst, daß dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altare und gehe hin, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe!“
Wichtiger noch und wohlgefälliger als die Opfergabe, das will der Heiland besagen, ist in den Augen Gottes, des Allwissenden und Allgerechten, die Erfüllung seines Gebotes: Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst! Er, vor dessen allgegenwärtigem Auge nichts verborgen ist, der Herz und Nieren durchforscht und hineinschaut bis in die geheimsten Falten der Seele, sieht vor allem auf die Gesinnung des Herzens und spricht danach sein Urteil über den Menschen.
Und dies sein Urteil bleibt unabänderlich, unwiderruflich. Denn vor Gott dem Herrn gilt kein Ansehen der Person. Was immer der Mensch Böses denkt und sagt von seinem Nebenmenschen, was er gegen ihn tut und unternimmt, findet seinen strengen, unerbittlichen Richter, wenn nicht hienieden schon, so doch in der Ewigkeit!
Wie der göttliche Heiland dies sein Gebot verstanden haben will, hat er unzweideutig erklärt: „Ihr wisst, daß den Alten gesagt wurde. Hasset eure Feinde! Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde! Tut Gutes denen, die euch hassen, betet für jene, die euch verfolgen und verleumden, damit ihr Kinder dessen seid, der seine Sonne aufgehen läßt über Gute und Böse und regnen läßt über Gerechte und Ungerechte!“
Wer Haß und Feindschaft im Herzen trägt wider seinen Nächsten, belügt sich selbst, wenn er zum Vater betet, der im Himmel ist: „Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!“ Derjenige, der diese Bitte uns gelehrt, hat uns durch sein Beispiel gezeigt, wie sie auch in die Tat umzusetzen ist, dadurch, daß wir dem Nächsten von Herzen verzeihen. Denn nur dann dürfen wir auch Vergebung erhoffen für unsere eigenen Sünden.
An Großmut läßt sich Gott wahrlich von niemandem übertreffen. Und nur wer großmütig verzeiht, ist seiner auch würdig. Darin unterscheidet sich das Christentum vom Heidentum, dem alten und neuen, sowie den anderen Religionen, auch der jüdischen, daß es die Religion der Liebe und Versöhnung ist: „Daran sollen sie euch erkennen, daß ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe!“
(nach: August Schmidlin, Empor die Herzen – Lesungen für die Sonn – und Festtage des Kirchenjahres; 1941, Verlagsbuchhandlung zum Münster, A.G., Straßburg)

 „Epiphanie“ (griechisch = Erscheinung) heißt im Lateinischen daneben auch apparitio, manifestatio, declaratio, ostensio Domini, Fest der Erscheinung des Herrn, d.h. der Offenbarung seiner Gottheit, ein Fest des Herrn am 6. Januar; heute ohne die seit dem 6. Jahrhundert übliche Vigil und auch ohne eine eigentliche Oktav, die für Jerusalem um 400 und für die römisch-fränkische Liturgie im 8. Jahrhundert bezeugt ist, wohl aber mit einer Art Nachfeier, deren 8. Tag abendländischer Tradition gemäß Commemoratio baptismatis D. N. J. Christi (= Fest vom Gedächtnis der Taufe unseres Herrn Jesus Christus) heißt. Die rein volkstümliche Bezeichnung festum magorum (= Fest der Magier) oder Fest der Heiligen Drei Könige in romanischen und germanischen Sprachdialekten hängt wohl besonders mit der Übertragung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln (1164) zusammen.
„Epiphanie“ (griechisch = Erscheinung) heißt im Lateinischen daneben auch apparitio, manifestatio, declaratio, ostensio Domini, Fest der Erscheinung des Herrn, d.h. der Offenbarung seiner Gottheit, ein Fest des Herrn am 6. Januar; heute ohne die seit dem 6. Jahrhundert übliche Vigil und auch ohne eine eigentliche Oktav, die für Jerusalem um 400 und für die römisch-fränkische Liturgie im 8. Jahrhundert bezeugt ist, wohl aber mit einer Art Nachfeier, deren 8. Tag abendländischer Tradition gemäß Commemoratio baptismatis D. N. J. Christi (= Fest vom Gedächtnis der Taufe unseres Herrn Jesus Christus) heißt. Die rein volkstümliche Bezeichnung festum magorum (= Fest der Magier) oder Fest der Heiligen Drei Könige in romanischen und germanischen Sprachdialekten hängt wohl besonders mit der Übertragung ihrer Gebeine von Mailand nach Köln (1164) zusammen. Mit dem Sonntag Septuagesima beginnt die sogenannte Vorfastenzeit. Die Vorfastenzeit verbindet sozusagen das Ende der Weihnachtszeit mit dem Beginn der Fastenzeit, welche mit dem Aschermittwoch beginnt. Die Namen der Sonntage Septuagesima (=70), Sexagesima (=60) und Quinquagesima (=50) bezeichnen nicht die genauen Abstände bis zum Osterfest, sondern sind aufgerundet.
Mit dem Sonntag Septuagesima beginnt die sogenannte Vorfastenzeit. Die Vorfastenzeit verbindet sozusagen das Ende der Weihnachtszeit mit dem Beginn der Fastenzeit, welche mit dem Aschermittwoch beginnt. Die Namen der Sonntage Septuagesima (=70), Sexagesima (=60) und Quinquagesima (=50) bezeichnen nicht die genauen Abstände bis zum Osterfest, sondern sind aufgerundet.

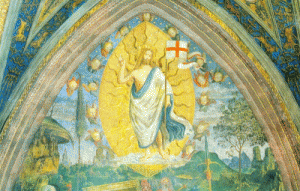 Mit der Himmelfahrt schließt das irdische Leben des göttlichen Heilandes ab. Sie ist das letzte Geheimnis des Erdenwandels und das erste Geheimnis des Himmels. Mit ihr erreicht die Verherrlichung des Heilandes die letzte Stufe.
Mit der Himmelfahrt schließt das irdische Leben des göttlichen Heilandes ab. Sie ist das letzte Geheimnis des Erdenwandels und das erste Geheimnis des Himmels. Mit ihr erreicht die Verherrlichung des Heilandes die letzte Stufe.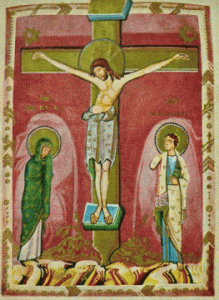
 Mit dem ersten Adventssonntag (27. November 2011) stehen wir an der Schwelle eines neuen Kirchenjahres. Schon der Name „Advent“ (lat. Adventus=Ankunft unseres Herrn) sagt, daß es eine Zeit der Erwartung ist, die nunmehr begonnen hat. Wen wir in diesen Tagen erwarten, das kommt in allen Gebeten und Gesängen unserer hl. Mutter, der Kirche, zum ergreifenden Ausdruck.
Mit dem ersten Adventssonntag (27. November 2011) stehen wir an der Schwelle eines neuen Kirchenjahres. Schon der Name „Advent“ (lat. Adventus=Ankunft unseres Herrn) sagt, daß es eine Zeit der Erwartung ist, die nunmehr begonnen hat. Wen wir in diesen Tagen erwarten, das kommt in allen Gebeten und Gesängen unserer hl. Mutter, der Kirche, zum ergreifenden Ausdruck. Der Monat November ist vielen von uns als Allerseelenmonat bekannt. Doch beginnt der Monat November mit dem Fest Allerheiligen, an dem die Kirche alle Heiligen im Himmel verehrt. Aber, wann ist ein Mensch ein Heiliger? Wann wird jemand als Heiliger verehrt? Zunächst einmal muß festgestellt werden: Gott ist der Allheilige. Es ist das Wesen des höchsten Gutes und der höchsten Güte, sich selbst gemäß, d.h. heilig zu sein. Gott ist auch der Urheilige, der vernunftbegabte Geschöpfe über die Möglichkeiten ihrer geschöpflichen Ordnung hinaushebt in eine übernatürliche und sie sich selbst gemäß macht und angleicht, sie heilig macht. Jedes vernünftige Geschöpf strebt zwar kraft seines Wesens nach Gott, seinem Ursprung, um in ihm Ruhe und Heimat zu finden. Aber welches Geschöpf dürfte wohl wagen, wie Gott sein zu wollen und sich eindrängen in das persönliche Leben Gottes? Das Geschöpf kann sich seinen Platz nicht wählen in der göttlichen Sphäre seines Schöpfers. Aber der Schöpfer kann – aus Gnade – das Geschöpf teilhaben lassen an seinem eigenen Leben. Und da Leben bei dem höchsten Geiste Erkennen und Lieben ist, muß der geschaffene Geist, der an seinem Leben teilhaben will, in seinem Erkennen dem göttlichen Geiste angeglichen werden.
Der Monat November ist vielen von uns als Allerseelenmonat bekannt. Doch beginnt der Monat November mit dem Fest Allerheiligen, an dem die Kirche alle Heiligen im Himmel verehrt. Aber, wann ist ein Mensch ein Heiliger? Wann wird jemand als Heiliger verehrt? Zunächst einmal muß festgestellt werden: Gott ist der Allheilige. Es ist das Wesen des höchsten Gutes und der höchsten Güte, sich selbst gemäß, d.h. heilig zu sein. Gott ist auch der Urheilige, der vernunftbegabte Geschöpfe über die Möglichkeiten ihrer geschöpflichen Ordnung hinaushebt in eine übernatürliche und sie sich selbst gemäß macht und angleicht, sie heilig macht. Jedes vernünftige Geschöpf strebt zwar kraft seines Wesens nach Gott, seinem Ursprung, um in ihm Ruhe und Heimat zu finden. Aber welches Geschöpf dürfte wohl wagen, wie Gott sein zu wollen und sich eindrängen in das persönliche Leben Gottes? Das Geschöpf kann sich seinen Platz nicht wählen in der göttlichen Sphäre seines Schöpfers. Aber der Schöpfer kann – aus Gnade – das Geschöpf teilhaben lassen an seinem eigenen Leben. Und da Leben bei dem höchsten Geiste Erkennen und Lieben ist, muß der geschaffene Geist, der an seinem Leben teilhaben will, in seinem Erkennen dem göttlichen Geiste angeglichen werden. Die Frohbotschaft von der Auferstehung unseres Herrn und Gottes Jesus Christus ist das zentrale Geheimnis unseres Glaubens. Es ist uns klar, daß diese Botschaft für unser Leben weitreichende Folgerungen nach sich ziehen muß. Dazu müssen wir über sie nachdenken, sie betrachtend erwägen.
Die Frohbotschaft von der Auferstehung unseres Herrn und Gottes Jesus Christus ist das zentrale Geheimnis unseres Glaubens. Es ist uns klar, daß diese Botschaft für unser Leben weitreichende Folgerungen nach sich ziehen muß. Dazu müssen wir über sie nachdenken, sie betrachtend erwägen. Die Jahreszeit des Herbst, in der wir uns nun befinden, erinnert uns an die Vergänglichkeit der irdischen Dinge. Auch unser Leben ist davon nicht ausgeschlossen. Ganz besonders der Monat November, indem wir uns nun befinden, ermahnt und erinnert uns daran, daß wir diese Welt einmal verlassen werden, um vor das Angesicht Gottes zu treten.
Die Jahreszeit des Herbst, in der wir uns nun befinden, erinnert uns an die Vergänglichkeit der irdischen Dinge. Auch unser Leben ist davon nicht ausgeschlossen. Ganz besonders der Monat November, indem wir uns nun befinden, ermahnt und erinnert uns daran, daß wir diese Welt einmal verlassen werden, um vor das Angesicht Gottes zu treten.
