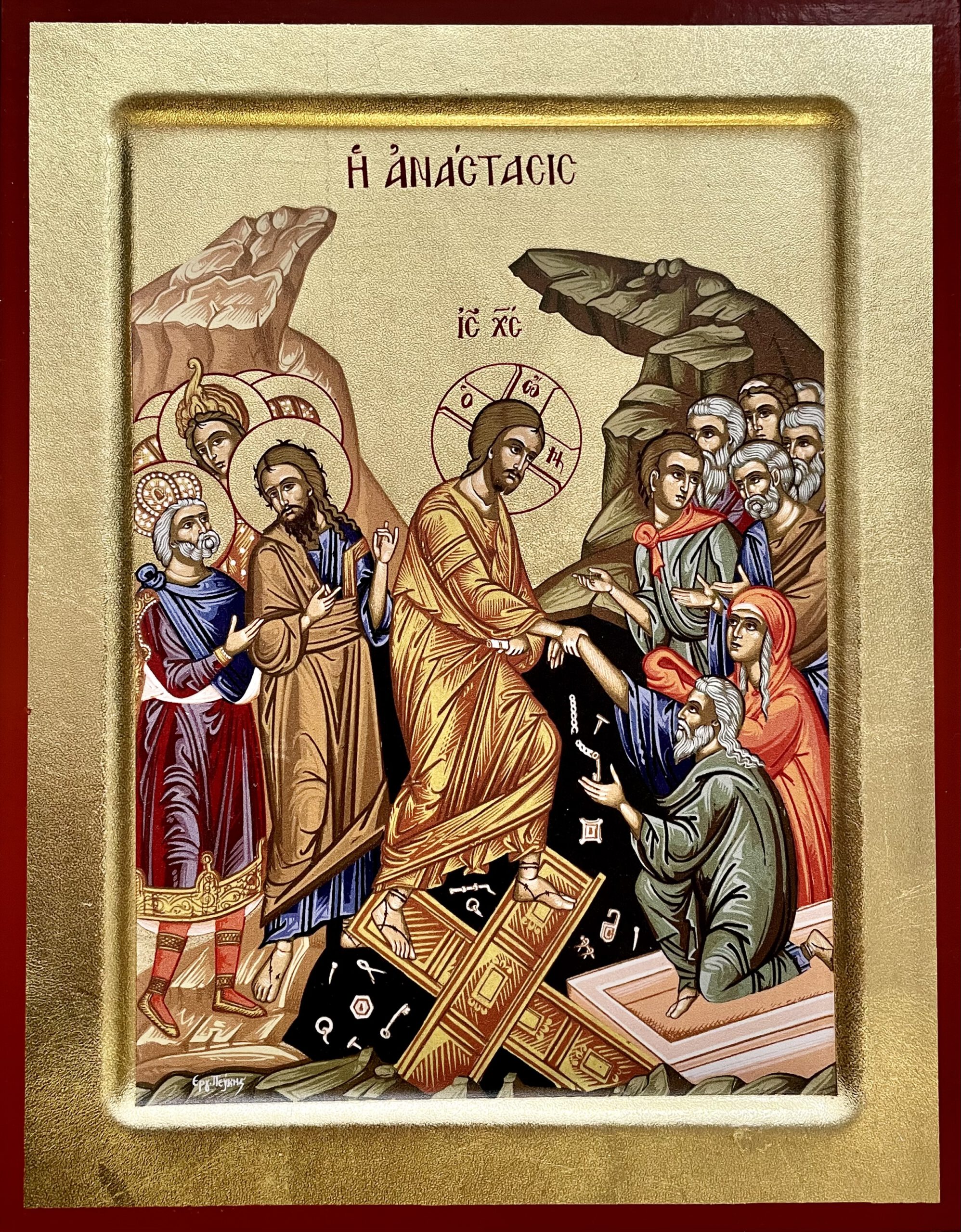Liebe Gläubige,
Liebe Gläubige,
vom hl. Augustinus sind die Worte überliefert: “Wäre dein Wort nicht Fleisch geworden und hätte es nicht unter uns gewohnt, hätten wir glauben müssen, dass es keine Verbindung gäbe zwischen Gott und der Menschheit – und wir wären verzweifelt.“
Die Menschwerdung Gottes ist ein so unaussprechliches Wunder, das sich nur den Menschen erschließt, die an die Allmacht Gottes glauben. Wenn laut einer aktuellen Umfrage, nur noch ca. 20 Prozent der deutschen Katholiken überhaupt an Gott glauben, dann ist klar, dass vom Weihnachtsgeheimnis nur noch ein weltliches Familienfest übrig bleibt. Dann bringt es auch nicht viel, mit den Kindern in der Kirche eine Weihnachtskrippe zu besuchen. In Recklinghausen gab es in einer Kirche eine sehr schöne Krippe. Ich verweilte vor Jahren dort längere Zeit im Gebet. Viele Menschen strömten an diesem Weihnachtstag in die Kirche, um die Krippe zu bestaunen. Aber nur ganz Wenige beugten ihre Knie vor dem im Tabernakel gegenwärtigen Herrn.
Wenn der hl. Augustinus von der Verzweiflung spricht, wenn es keine Verbindung zwischen Gott und den Menschen gäbe, dann wird diese Aussage mehr oder weniger durch die Realität belegt. Denn was kann in schwieriger Lage, bei Krankheit und Tod, bei Zerstörung und Krieg noch anderes Halt geben, als der Glaube und das Vertrauen auf Gott? Spüren wir nicht, wie angesichts der desolaten Lage in der Welt, in der die Politik für die gewaltigen Probleme keine Lösungen mehr parat hat, sich allgemein Unzufriedenheit, Resignation, Angst und Gewalt ausbreiten? Diesen Versuchungen kann der gläubige Christ widerstehen, denn er hat seinen Halt und seine Zuversicht in Gott und dessen Vorsehung. „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ Das ist die letzte Strophe eines Textes, den der von den Nazis ermordete evangelische Pastor Dietrich Bonhoeffer am 19. Dezember 1944 aus dem Gefängnis des Reichssicherheitshauptamts in Berlin an Maria von Wedemeyer geschrieben hat. Wir wissen uns wie Dietrich Bonhoeffer in Gott geborgen. Er ist der wahre Herrscher dieser Welt, nicht die Tyrannen in Moskau, Peking, Teheran oder sonstwo. Der Stern von Bethlehem und das Licht Christi leuchtet in der Finsternis dieser Welt und wird nicht erlöschen, bis er eines Tages auf den Wolken kommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Unser Blick geht darum über diese Erdenzeit hinaus und ist auf das ewige Leben gerichtet.
Wenn man mich fragt, über was ich mich am meisten im zu Ende gehenden Jahr gefreut habe, dann ist meine Antwort eindeutig: die Wunder, die Gott in den Seelen wirkt. Ich möchte das nicht auf die großen Wunder einer Bekehrung beschränken, obwohl sie eine besonders große Freude sind. Es sind auch die kleinen Wunder, an denen man das Wirken der Gnade Gottes ablesen kann. Menschen, die sich von der Liebe Gottes berühren lassen. Gnade, die Versöhnung bewirkt. Barmherzige Liebe, die sich Menschen gegenseitig schenken. Es gibt so viel Gutes und Schönes, was nicht den Weg in die Zeitung und die Medien findet. Wir haben wunderbare Familien und zahlreiche junge Leute in unseren Reihen. Viele Gläubige haben sich unserer Seelsorge an unseren Messorten im Rheinland und Bergischen Land und darüber hinaus anvertraut. Für dieses Vertrauen sind wir allen sehr dankbar. Meine Mitbrüder und ich sind bemüht, dieses Vertrauen entsprechend zurück zu geben. Nicht allen Erwartungen sind wir gerecht geworden. Auch wir Priester bleiben mehr oder weniger hinter dem Ideal zurück und sind auf Gottes Barmherzigkeit und Ihre Nachsicht angewiesen. Danken möchte ich besonders all jenen, die uns an den verschiedenen Messorten und auch im Haus unterstützen und das Gemeindeleben durch ihren Einsatz mittragen. Ebenso unseren Wohltätern, ohne die wir das Apostolat nicht leisten und finanzieren könnten. Natürlich auch allen, die regelmäßig unter nicht geringen Opfern die hl. Messen besuchen und dafür mitunter weite Anfahrtswege in Kauf nehmen. Wir haben das Glück, das wir einen uns sehr wohlgesonnenen Erzbischof vor Ort haben, der Gott sei Dank trotz aller Widrigkeiten, Schwierigkeiten und Gegnerschaft den Mut noch nicht verloren hat und weiterhin seinen Dienst ausüben kann. Beten wir für ihn und die Mitglieder der Bistumsleitung!
Gott segne Sie und Ihre Familien, eine frohe und gnadenreiche Weihnachtszeit und ein gutes, gesegnetes Jahr 2024 wünschend, auch von meinen Mitbrüdern, Pater Fuisting und Pater Unglert
Ihr Pater Bernhard Gerstle


 Jesus steht in souveräner Größe und königlicher Hoheit vor dem Volk und Pontius Pilatus, dem römischen Landpfleger. Äußerlich scheint es so, als wäre Jesus ohne Macht, allein, ohne Hilfe, und doch spricht er furchtlos von der wahren Größe, dem wahren Reich und der wahren Macht, die ihm gegeben ist.
Jesus steht in souveräner Größe und königlicher Hoheit vor dem Volk und Pontius Pilatus, dem römischen Landpfleger. Äußerlich scheint es so, als wäre Jesus ohne Macht, allein, ohne Hilfe, und doch spricht er furchtlos von der wahren Größe, dem wahren Reich und der wahren Macht, die ihm gegeben ist.
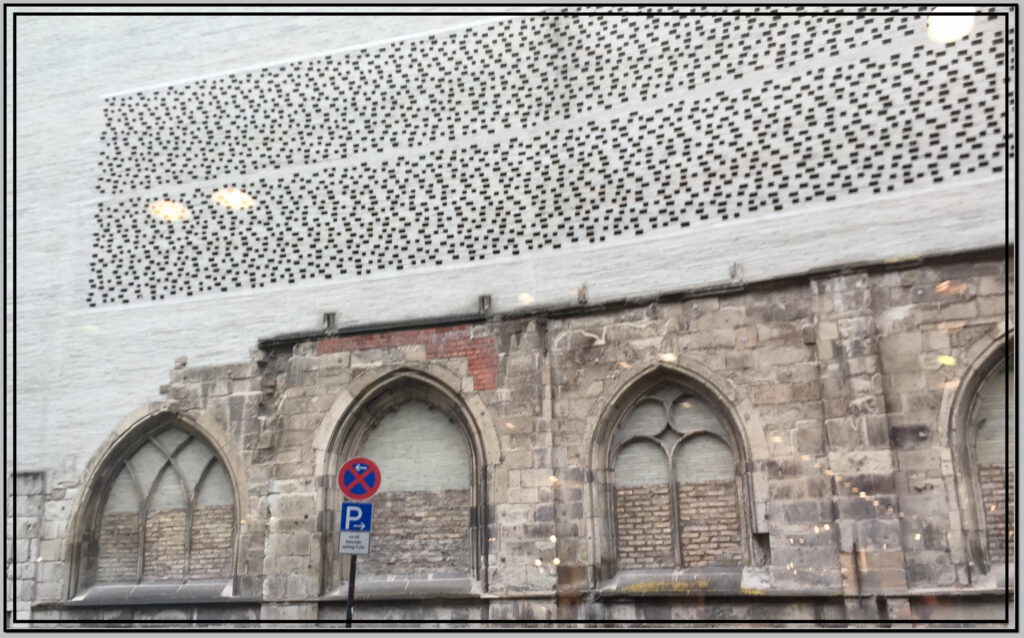


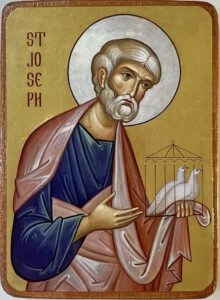



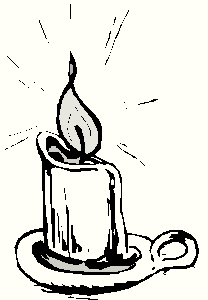
 im Advent begegnet uns in der Liturgie immer wieder die Gestalt des heiligen Johannes des Täufers. Sein Programm lautet: “Er muss wachsen, ich aber abnehmen” (Joh 3,30)! Es ist ein Kontrastprogramm zum weit verbreiteten Egoismus, der uns seit der Sünde unserer Stammeltern im Paradies im Griff hat.
im Advent begegnet uns in der Liturgie immer wieder die Gestalt des heiligen Johannes des Täufers. Sein Programm lautet: “Er muss wachsen, ich aber abnehmen” (Joh 3,30)! Es ist ein Kontrastprogramm zum weit verbreiteten Egoismus, der uns seit der Sünde unserer Stammeltern im Paradies im Griff hat.